Die Farbe der Aufklaerungzurück zur Seite Farbsymbolik Andreas HebestreitMan fühlt den Glanz von einer neuen Seite,
auf der noch alles werden kann.Gedanken zur Farbe der Aufklärung
Vortrag, gehalten am 12. September 2009 vor der Schweizerischen Gesellschaft für Symbolforschung in Zürich. (Copyright beim Verfasser)

Man fühlt den Glanz von einer neuen Seite, auf der noch alles werden kann – Das war natürlich Rainer Maria Rilke. Aber dieser Glanz von einer neuen Seite, auf der noch alles werden kann, das ist vor allem auch – die Farbe der Aufklärung. Gestatten Sie mir, bevor wir uns nun in unser Thema vertiefen, ein paar grundsätzliche Überlegungen. Über Farben sprechen setzt Farbwörter voraus und was diese Farbwörter betrifft, so ist hier an eine Diskussion zu erinnern, die im 19. Jahrhundert durch eine Arbeit des späteren britischen Premierministers William E. Gladstone ausgelöst wurde. Gladstone hatte bemerkt, dass die Griechen der homerischen Zeit noch kein gesondertes Wort für grüne Farbeindrücke besaßen. Für diese etwas seltsame Tatsache, die aber, wie man bald bemerkte, keineswegs isoliert dastand, wurden dann in gelehrten Kreisen verschiedene Erklärungen gesucht. Man spekulierte insbesondere über die Frage, ob sich die menschliche Farbwahrnehmung, der Farbensinn gleichsam in evolutionären Schritten entwickelt habe. Eine erste Klärung brachte hier ein deutscher Augenarzt namens Hugo Magnus, der nachweisen konnte, dass erstens alle Menschen in allen uns bekannten Kulturen alle Farben sehen können. Und zweitens, dass unsere Farbbezeichnungen tatsächlich nach und nach entstanden sind. Letzteres wäre allerdings noch nichts Besonderes. Man kann sich ja sehr gut vorstellen, dass die Farbbezeichnungen in den verschiedenen Kulturen in unterschiedlicher Weise ausfallen und heranwachsen. Tatsächlich konnte nun aber durch die Forschungen des britischen Ethnologen W. H. Rivers der Nachweis erbracht werden, dass wir es hier mit einer eigentümlichen Gesetzmäßigkeit zu tun haben. Das heißt, die Farbbezeichnungen haben sich in allen uns bekannten Kulturen in der gleichen Reihenfolge entwickelt. Natürlich hat es danach verschiedene Anläufe gegeben – meist physiologischer Art, diese anthropologische Universalie zu erklären. Aber es war nicht zuletzt die Unzufriedenheit mit allen diesen Erklärungen, die mich vor über zehn Jahren dazu geführt hat, eine eigene Erklärung zu suchen und das Buch »Die soziale Farbe« in Angriff zu nehmen. In der Art, wie mit den Farbbezeichnungen Farben ergriffen werden, spiegeln sich nach meiner Überzeugung primär soziale Gegebenheiten. Das klingt nun zunächst wie eine mögliche Hypothese neben anderen möglichen Hypothesen. Ich muss also noch ein bisschen nachlegen. Der Fehler, den man bisher gemacht hat, bestand darin, dass man glaubte, Farbbezeichnungen entstünden einfach als eine Art semantischer Reflex auf einen bestimmten Sinneseindruck. Der grüne Wald, die grüne Au, der grüne Lenz, das alles drängt sich und uns zu dem Wort grün. Diese Auffassung ist falsch! – Es gibt innerasiatische Hirtenvölker, die während Jahrhunderten und Jahrtausenden durch die Steppen gewandert sind, immer auf der Suche nach saftigen grünen Weiden, aber – ohne ein Wort für grün. Ein Wort für grüne Farbeindrücke gibt es erst dann, wenn es Menschen gibt, die sich mit dieser grünen Farbe identifizieren wollen. Menschen, die in dieser Farbe etwas erkennen, das mit ihnen, mit ihrem Sein und Wollen übereinstimmt. Damit hätten wir also die Bezeichnungen für die einzelnen Farben. Aber damit sind wir noch nicht am Ziel. Denn, so überraschend das tönen mag, die einzelnen Farben sind die reine Illusion. Um das einzusehen, muss man sich nur den bekannten Satz umkehren, dass die Farben relativ seien, dass also jede Farbe immer durch ihren oder ihre Nachbarn beeinflusst wird, und schon gelangt man zu der Einsicht: Es gibt keine absolute Farbe, es gibt keine Farbe per se. Was es wirklich gibt, sind immer Farbzusammenstellungen, Farbkombinationen oder – wie man manchmal in der Welt des Designs sagt – Farb-Codes. Ich persönlich empfehle und verwende hier das Wort »Farbgesellschaften«. Was nun diese Farbgesellschaften betrifft, so hat man sich bisher in der Theorie nur sehr zögerlich mit ihnen befasst – wenn überhaupt – und der Grund dafür ist nur allzu offensichtlich. Wenn wir nämlich bereits Stunden und Tage brauchen, um uns über die Bedeutung und die Geschichte einzelner Farben zu verständigen, was passiert, wenn wir Zweier-, Dreier- oder gar Vierergruppen von Farben in Betracht ziehen wollten? In den verschiedensten Gewichtungen? – Man wäre sehr bald in astronomischen Bereichen und folglich lässt man lieber die Finger davon. In Wirklichkeit kann man sehr wohl sinnvoll über Farbgesellschaften sprechen, vorausgesetzt, man legt sich ein geeignetes deskriptives Schema zurecht. Dieses deskriptive Schema sieht etwa folgendermaßen aus: 1. Es gibt große und kleine Farbgesellschaften. Und zwar ausgehend von einem Mittelwert, welcher in dem Fall eine Dreizahl ist. Weniger als drei ist klein, mehr als drei – also etwa bis sieben oder acht – ist groß. 2. Es gibt Farbgesellschaften, die gesamthaft im hellen, gesättigten, leuchtenden Bereich angesiedelt sind, und solche, die eher im dunklen, gedämpften, matten Bereich angesiedelt sind. 3. Es gibt Farbgesellschaften, die spannungsvoll sind und es gibt vergleichsweise spannungslose, gleichsam rein aufzählende, parataktische.
Man könnte das natürlich noch um einiges ausbauen und verfeinern, aber für den Moment und unsere Zwecke soll es genügen. Damit wären die methodischen Präliminarien abgeschlossen und wir können uns dem eigentlichen Thema zuwenden, das nun allerdings nicht mehr »Die Farben der Aufklärung« heißen soll, sondern »Die symbolische Bedeutung der Farbgesellschaften der Aufklärung«. Die Frage nach der Bedeutung eines Symbols hat für mich nur dann einen Sinn, wenn wir uns so weit als möglich darüber klar werden, wer dieses Symbol gebraucht oder gebraucht hat, wann und unter welchen Umständen. Letzten Endes ist das auch ein demographischer Ansatz, wie ihn unter anderem der französische Historiker Pierre Chaunu angewendet hat. Nach seiner Überzeugung ist die Verdoppelung der europäischen Bevölkerung die erste gesicherte Tatsache im Zeitalter der Aufklärung.
Es gab also im 18. Jahrhundert auf einmal mehr Menschen in Europa. Junge, lebenshungrige Menschen, die unbedingt einen Platz in einer Gesellschaft finden mussten, die ihnen, eben weil sie ihren Platz erst noch suchen mussten, plötzlich als zu eng und zu engherzig erschien. Nun gab es da viele, die sich gegenüber dieser Tatsache einigermaßen indifferent verhielten, aber es gab auch einige wenige progressiv eingestellte Persönlichkeiten, die diese explosive demographische Entwicklung nicht ruhen ließ. Das waren Leute, die gemeinnützige Sozietäten und Reformgesellschaften gründeten, die Akademien ins Leben riefen, welche sich mit konkreten sozialen Problemen beschäftigten, die popularphilosophische Broschüren veröffentlichten, gegen Analphabetismus und für die Volksgesundheit. Aber, so wertvoll dieses große Unternehmen, überkommene wirtschaftliche, technologische und religiöse Barrieren zu überwinden und dadurch mehr Raum zu schaffen für die heranwachsenden und kommenden Generationen, im einzelnen sein mochte, in einem ganz entscheidenden Punkt blieb das aufklärerische Unternehmen doch beschränkt, nämlich im politischen. Es gab zwar den aufgeklärten Absolutismus, in dem einzelne Monarchen die Initiative ergriffen, aber das tragische Scheitern der josephinischen Reformen im Habsburgerreich ist hier vielleicht doch symptomatisch. Etwas anders lagen die Dinge in England. Dazu muss man sich zunächst vergegenwärtigen, dass sich die Einwohnerschaft Londons zwischen 1500 und 1650 nicht nur verdoppelt oder verdreifacht, sondern verachtfacht hat. Zudem durchlebte England zwischen 1620 und 1650 eine seiner schwersten wirtschaftlichen Krisen. Die Anforderungen, die sich damit stellten, waren also enorm. Aber, man muss sagen: Entsprechend bedeutsam waren auch die Lösungen. Ich erwähne hier nur als Stichwörter die Glorious Revolution von 1688 und die ein Jahr später verabschiedete Bill of Rights. Die Gewaltenteilung, über die man auf dem Kontinent allenfalls theoretisieren konnte, war in England bereits in erheblicher Weise verwirklicht. Hier, in der konstitutionell gefassten Aufwertung der Volksvertretung gegenüber der Krone liegt der wahre Grund für das Primat der englischen Aufklärung.
Aber was hat das alles mit der Farbe zu tun? Die verschiedenen Farbeindrücke sind wie gesagt nach und nach sprachlich erfasst worden. Indem sie sprachlich erfasst wurden, indem also neben die Farbeindrücke nach und nach auch die entsprechenden Farbwörter traten, wurden die Farben erst zu Symbolen. Vorher war die Farbe sprachlos und die Sprache farblos. Sind die Farbeindrücke aber einmal zur Sprache gekommen, dann gilt für sie, was im übrigen auch für alle anderen Symbole gilt: Sie dienen uns dazu, die uns umgebende Wirklichkeit zu erfassen, zu gliedern, zu ordnen, zu begreifen – wenn nicht gar in schöpferischer Mimesis nachvollziehend hervorzubringen. Dieser Satz gilt, wie gesagt, für alle Symbole, aber er gilt für die Farben in besonderer Weise, weil wir nicht nur die Farbeindrücke über die Farbwörter ergreifen, sondern weil wir darüber hinaus die Farben selbst zuweisen können. Es ist also gewissermaßen ein potenzierter Zugriff auf die Wirklichkeit, der uns hier zu Verfügung steht. Zunächst ein rein sprachlich Benennender, aber dann auch ein vollkommen pragmatischer, der sich namentlich in Akten des Färbens, Malens, Bemalens und Bekleidens artikuliert. Überall wo gefärbt, bemalt oder bekleidet wird, da wird zugleich ein Stück Wirklichkeit behauptet und in Anspruch genommen – da wird Welt gewonnen. Aus einer Welt, wie sie ist, wird eine Welt, wie sie – für uns – sein soll. Eine Welt, die uns werden soll. Wenn wir uns fragen, wie sich das alles in einer Farbgesellschaft abbilden kann, dann müssen wir zurück zu unserem Analysemodell. – Angesichts einer sozialen Situation, die darauf drängt, Beschränkungen aufzuheben, wird die erwartete Farbgesellschaft eher weit als eng gefasst sein. Angesichts einer Situation, in der es darauf ankommt, die Menschen besser zu unterrichten, damit sie sich selber besser helfen können, wird die erwartete Farbgesellschaft eher im hellen als im dunklen Bereich angesiedelt sein. – Ich erinnere hier nur an den englischen Ausdruck ›to see the light‹ – zur Einsicht kommen. Und angesichts der Tatsache, dass es hier um eine Gesellschaft geht, in der sich eine verfassungsmäßig gesicherte Rechtsgleichheit durchgesetzt hat, wird man eine Farbgesellschaft erwarten dürfen, die in schöner Äquidistanz auftritt. Tatsächlich kennt die englische Sprache in dieser Zeit den Ausdruck equal colours, womit die einfachen, ungemischten Farben gemeint sind. Wenn man nun diese Überlegungen sachlich auswertet, dann entsteht vor unseren Augen ein Gebilde, das von keinem Geringeren als Isaac Newton entworfen wurde – das zum Kreis gebogene und durch Violett ergänzte Spektrum – der Farbkreis. Also ein gleichmäßig unterteilter Kreis mit den sieben Farben (in seiner Orthographie) Red, Orange, Yellow, Green, Blew, Indico und Violet-Purple. Die kreisförmige Darstellung einer Farbgesellschaft gab es zwar schon 1626 bei Robert Fludd, aber Newtons Farbkreis ist insofern neu, als er sich nahezu ausschließlich aufs Empirische stützt – nahezu. 
Ich habe jetzt wie ganz selbstverständlich vom ›Farbkreis‹ gesprochen, weil das offenbar so gebräuchlich ist, aber – ich muss das korrigieren. In den lateinisch abgefassten Texten ist hier nämlich von einem anulus die Rede, also einem ›Ring‹. Der Unterschied ist: Ein Kreis ist etwas Statisches, ein Ring oder ein Rad kann sich drehen. Das Spektrum ist also zum Rad und zum Zyklus gebogen worden. Und das macht sogleich deutlich, worauf es nach der Glorious Revolution in England ankommt oder besser, worum es sich nach der Glorious Revolution in England dreht, nämlich um die konstitutionelle rotation, will sagen um die verfassungs- und gesetzmäßig geregelte rotation in office. Indem Newton das Farbspektrum zu einem Ring oder Rad geformt hat, ist damit auch etwas Philosophie eingeflossen – Philosophie hier in dem Sinn, in dem das achtzehnte Jahrhundert das Wort verstanden hat – denn tatsächlich sind die Farben im Spektrum ja keineswegs equal vertreten. Indem Newton seinen Farbenring aber in vollkommen gleich große, gleich wertige und gleich rangige Segmente unterteilt, spricht er das Prinzip der equality an, der égalité, der naturgegebenen Rechts-Gleichheit – unter den Menschen und den Mächten. Ich würde nun gerne das Newtonsche Spektrum als das große Siegeszeichen präsentieren, mit dem die englische Aufklärung den Kontinent erobert hat und gesellschaftlich wirksam geworden ist, aber in Wirklichkeit haben sich die Dinge etwas langsamer entwickelt. 1672 erschien die erste große Abhandlung Newtons über Licht und Farbe. Diese auch innerhalb der Royal Society zunächst heftig befehdete Abhandlung wurde in Paris umgehend gelesen, stieß aber überwiegend auf höfliche Skepsis, die sich bald zu klarer Ablehnung verhärtete, worauf dann allgemeines Stillschweigen folgte. – Und dabei wäre es möglicherweise geblieben. Wenn es nicht dabei geblieben ist, so wohl deshalb, weil das achtzehnte Jahrhundert den Begriff der Philosophie noch etwas weiter und umfassender gebraucht hat als wir das heute gewohnt sind. Der Oberbegriff ›Philosophie‹ umschloss auch die naturwissenschaftliche Spekulation und die Überlegungen zu Literaturkritik und Kunsttheorie. Auch das war Philosophie und diese Art von Philosophie hat dann im Verlauf der nächsten dreißig Jahre wesentlich dazu beigetragen, dass es mit den Anschauungen Newtons zum entscheidenden Durchbruch gekommen ist. Wobei diese Bemühungen durch eine weitere Tatsache befördert wurden, die in der Wissenschaftsgeschichte immer wieder eine wohltätige Rolle gespielt hat: Die dogmensprengende Kraft des Generationenwechsels. Einer der wichtigsten Fürsprecher Newtons in Frankreich, das vormalige mathematische Wunderkind Alexis Clairaut, wurde erst 41 Jahre nach der erwähnten Erstveröffentlichung Newtons geboren.
Nun aber zeigen sich Farbspektrum und Farbenring als das große Fanal. Konkret geht es beim newtonschen Farbenring um zwei Dinge: Aufwertung der Farbe und Ausweitung der Farbe. Allein schon, dass sich die Gelehrsamkeit nun so eingehend mit der Farbe befasst, die doch als etwas Wandelbares, Ephemeres, völlig Oberflächliches galt, bedeutet eine Aufwertung der Farbe. So verschmäht es Lessing als Gelehrter keineswegs, sich eingehender mit der Geschichte der Ölfarbe zu beschäftigen, und Diderot betrachtet es als durchaus sinnvoll, eine sehr gründliche Untersuchung über das Malen mit Wachsfarben, die schon den Ägyptern bekannte Enkaustik, zu verfassen. Schließlich wird die bereits im späten 17. Jahrhundert diskutierte Frage der Rangordnung von dessin und coloris durch Roger de Piles eindeutig zu Gunsten der Farbe entschieden. Farbe ist kein bloßes Akzidenz der Form, nicht nur schmückende Zugabe, Farbe bedeutet ›Beseelung‹ der Form. Vergessen wir einmal die abgenutzte, nie sehr zutreffende Schulformel von der Aufklärung als dem ›Zeitalter der Vernunft‹ und denken wir stattdessen an Chamforts Maxime, wonach der Mensch mehr durch seine Vernunft verdorben worden sei als durch seine Leidenschaften. Für den Aufklärer David Hume ist die Vernunft nicht nur die Dienerin der Gefühle, Emotionen und Leidenschaft, sondern sie soll das auch durchaus sein. – Wozu reibt ihr überhaupt Farben an? fragt Diderot die Künstler seiner Zeit, wenn mich das Ergebnis dann weniger berührt als irgendein Zeitungsbericht. Gestützt wird das alles durch verschiedene Schriften zur Ästhetik, die nun plötzlich aufblühen. Man sieht auf einmal mehr Farben – oder man glaubt zumindest, mehr Farben zu sehen. Wenn Raffael heute wiederkommen würde, schreibt der Abbé Du Bos, dann würde er noch bessere Bilder malen. Die Natur hat sich perfektioniert. Von den Farben, die wir heute kennen, hatte Raffael noch gar keine Ahnung. – So glaubte zumindest der Abbé Du Bos. Dass es nach 1675 ausgerechnet englische Jesuiten waren, die Newtons physikalische Versuche in Zweifel zu ziehen wagten, erschien in den Kreisen der Aufklärer, die den Jesuiten bekanntlich durchwegs ablehnend gegenüberstanden, fast schon wie eine weitere, nunmehr indirekte Bestätigung. Aber für uns, die wir uns ja hier nicht mit Wissenschaftsgeschichte zu befassen haben, sondern mit Symbolgeschichte, ist es doch besonders bemerkenswert, dass es vor allem eine Persönlichkeit war, die Newtons Lehren auf dem Kontinent zum Durchbruch verholfen hat und die man nach heutigen Begriffen kaum als Naturwissenschaftler bezeichnen würde, nämlich Voltaire. Goethe versucht 1805 in einem Rückblick auf das vergangene achtzehnte Jahrhundert die einzigartige Bedeutung von Voltaire für die Epoche der Aufklärung zu schildern und es fallen ihm, gleichsam völlig überwältigt, nur noch lauter Substantive ein. Die Liste beginnt mit Tiefe, Genie, Anschauung, Erhabenheit, Naturell und sie umfasst schließlich 46 Hauptwörter. – Zur heiteren Übersicht, wie Goethe sagt und das ist tatsächlich keine schlechte Charakterisierung für das, was auch das Farbspektrum für die Aufklärung bedeutet hat: eine in prägnanten Schlagwörtern zusammengefasste, aber dafür außerordentlich lichte, helle, heitere Übersicht über das der Menschheit Notwendige und Nützliche. 
Und Voltaire, von dem sein Biograph Condorcet später sagte, er habe mit der Palette Vergils einem von Newton abgezirkelten Gemälde die Farbe gegeben, unternimmt es tatsächlich, das newton’sche Farbspektrum zu verbreiten. Unter anderem auf poetische Art in der Märchenerzählung Die Prinzessin von Babylon. Ausweitung und Aufwertung der Farbgesellschaften entspricht einem vermehrten Verlangen nach einer neu anzustrebenden, neu zu ergreifenden Ganzheit. Verstanden in einem gesellschaftlichen wie in einem individual-psychologischen Sinn. Im alles überspannenden Symbol, im großen Regenbogen, artikuliert sich das drängende Bedürfnis nach einem neuen, besseren und gerechteren contrat social – einem Gesellschaftsvertrag, der einige ganz wesentliche Ergänzungen und einige wohltätige Korrekturen aufweisen soll. Die Brücke der Iris steht als Symbol für eine emphatische Großzügigkeit, für ein großes Geschenk, an dem nun einmal wirklich alle teilhaben sollen. Noch für Friedrich Schiller ist die bunte Brücke auf der Iris durch den Himmel schwebt, der bildhafte Ausdruck einer schönen Gabe, einer menschheitsbeglückenden Fülle und Vielfalt. 
Der Regenbogen bildet die große Klammer, das große Versprechen am Hoffnungshorizont, aber gerade in dieser Größe liegt auch eine gewisse Schwäche. Der Regenbogen ist ein bisschen allzu großartig, allzu umfassend und folglich unfassbar. Er ist ein leuchtendes Ideal, aber eben damit auch ein unerreichbares. Gibt es nicht eine Farbgesellschaft, die etwas praktikabler, realistischer und irdischer ist, die eher in unserer Reichweite liegt? – Es gibt sie! Tatsächlich zeigt sich im achtzehnten Jahrhundert ein erstaunliches Interesse an dem, was die Gelehrten im deutschsprachigen Raum manchmal die steinschalichten Thierlein nennen. Also die Muscheln, von denen manche bekanntlich einen besonders schönen Perlmutt- oder Iris-Effekt aufweisen. Eine wahre Konchiliomanie bricht aus, über die Rousseau spottet. Diese Muschelmanie hat eine ganze Reihe von Konnotationen. Nicht nur künstlerische oder modische. Zunächst ist da der enzyklopädische Aspekt – das große Weltinteresse, der um sich greifende Exotismus. Ich denke dabei insbesondere an unsere pazifischen Antipoden in der Südsee, von wo die englischen, französischen und niederländischen Seefahrer unter anderem auch einige sehr schöne Muschel-Exemplare nach Europa bringen. 
Dann der kreationistische Aspekt der Muscheln, den Voltaire unter anderem in seiner philosophischen Erzählung Der Mann mit den vierzig Talern behandelt und der erklärt wissen will, warum man in den europäischen Gebirgen versteinerte Abdrücke von Muscheln gefunden hat. Zu dieser angeregten Diskussion hat unter anderem auch Johann Jakob Scheuchzer beigetragen. Die Aufwertung der Farbigkeit berührt aber auch den Umgang zwischen den Geschlechtern, respektive die Aufwertung des weiblichen Geschlechts, das nun einmal eine besondere Affinität zur Farbe zu besitzen scheint. Es geht hier natürlich noch längst nicht um Emanzipation im Sinne des neunzehnten Jahrhunderts, aber wenn wir an die bekannten Namen der Pariser Salons denken, dann sind das sicherlich Meilensteine. In diesen Salons wurde denn auch mit einiger Genugtuung vermerkt, dass es eine Frau war, genauer die Lebensgefährtin Voltaires, seine unsterbliche Emilie, die Minerva Frankreichs, die Marquise du Châtelet, die mit ihrer Übersetzung und Kommentierung Newtons wesentlich zu dessen Erfolg auf dem Kontinent beigetragen hat. Ganz in diesem Sinn und Geist erboste sich Diderot über einen Verfasser, der etwas unaufgeklärte Ansichten über die Frauen verbreitet hatte: Wenn man über die Frauen schreiben will, muss man seine Feder in den Regenbogen tauchen! In England konnte man das fast schon wörtlich nehmen, denn dort gab es für die Damen der obersten Gesellschaftsschicht ein transcendent and divine powder, das tatsächlich aus zerstoßenen Perlen hergestellt wurde. – Man könnte sich vorstellen, dass so ein mit Perlenstaub bepudertes Gesicht eher an einen Fischmarkt erinnert, aber der britische Modegeschmack war wohl schon lange vor Vivienne Westwood immer etwas Besonderes und lässt sich vom Kontinent aus nur bedingt beurteilen. Immerhin, und das genannte pearl powder macht es noch einmal deutlich: Mit der Zeit wird die irisierende Farbe, die man namentlich auf der Innenseite der Muscheln zu sehen bekommt, etwas fragwürdig. So betont der Ästhetiker Baumgarten nach der Mitte des Jahrhunderts den Unterschied zwischen den colores austeri und den colores floridi und warnt davor, dass bei einer falschen Verwendung der Farben der Eindruck eines fucus aestheticus entstehen könne – das Gefühl einer ästhetische Schminke. Fragwürdig wird das irisierende Farbenspiel der Muscheln aber auch deshalb, weil die Muscheln zu nahe beim Style rocaille stehen, der sich ebenso erschöpft hat wie die darin verkörperte Herrschaft des Louis Quinze. 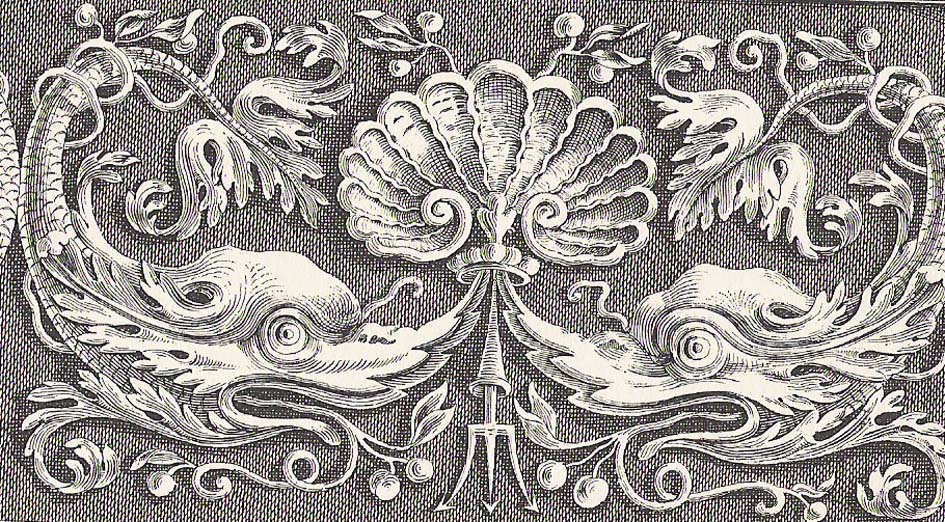

Der Style rocaille war immer mehr zur Signatur der herrscherlicher Willkür geworden und folglich zum Ärgernis. Die bürgerliche Welt sieht im schimmernden Perlmutt eine Farbgebung, die nicht haftet, die für nichts haftbar gemacht werden kann. Die nur selbstgefällig glänzt, aber nicht erleuchtet. Die Farbigkeit des Perlmutt wird als unzuverlässig, als verantwortungs- und charakterlos empfunden. Sie erinnert an das Verhalten des Höflings – der in der zeitgenössischen Literatur gelegentlich auch mit dem Chamäleon verglichen wird. Bei Christian Garve findet sich die Wendung von der Verehrung der Großen bloß um des äußern sie umgebenden Schimmers willen. Es entsteht also das Bedürfnis, diesen edlen aristokratischen Schimmer ein wenig zu hinterfragen, ihn ein bisschen anzukratzen, aufzurauhen, wenn nicht gar schon stellenweise anzuschwärzen. Wobei sich auch hier wieder die Dynamik des Generationenwechsels bemerkbar macht. Wir haben es mit einer neuen, zunehmend ungeduldigeren Generation zu tun – Diderot ist 19 Jahre jünger als Voltaire. Herder wird 21 Jahre nach Diderot geboren – und damit verstärken sich auch die Zweifel an diesem etwas allzu schillernden Farbgebaren, das sich dabei jeder Verantwortung entzieht. Bildhaft für den aristokratischen »Ausbruch in die Unbelangbarkeit« (O. Marquard) sind unter anderem die herrschaftlichen Fasanerien. Längst nicht jedem war es gestattet, diese überaus farbenprächtigen Vögel zu halten oder zu jagen. In Brandenburg-Preußen mussten selbst Adelige und begüterte Standespersonen um Erlaubnis einkommen, bevor sie Fasanen halten durften. Allzu farbenprächtiges Gefieder hat auch der junge Herder vor Augen, wenn er die zeitgenössische deutsche Literatur kritisiert als Paradiesvogel, so bunt, so artig, ganz Flug, ganz Höhe und – ohne Fuß auf die deutsche Erde. – Gerade Herder zeigt eine besondere Sensibilität in Bezug auf die allzu brillierende Farbe, was sich möglicherweise sogar medizinisch begründen ließe. Im Zusammenhang mit dem französischen Theater spricht er zum Beispiel von Leuten, die in das Gleißende vernarrt seien. Und in seinen Gedanken zur Malerei warnt er vor hereingemalten blendenden Farbstreifen, die dem ganzen Kunstwerk die Grazie rauben könnten. Bei Herder findet sich aber vor allem eine weitere, treffende Metapher für das, was als feudal vereinnahmte Farbigkeit empfunden wird – und zwar sind das – die Seifenblasen. 
Das sind nun nicht mehr die schönen, wenn auch hochexplosiven, mit Wasserstoff gefüllten Blasen, die in Professor Lichtenbergs Vorlesungen zur allgemeinen Ergötzung an die Decke seines Göttinger Hörsaals steigen, das ist vielmehr der Inbegriff glänzender, bunter Aufgeblasenheit und charakterlicher Nullität. Das Wort von den bunten Seifenblasenidealen findet sich bei Goethe bereits 1772. Was kann man tun, wenn die politischen und gesellschaftlichen Umstände allzu hohl wirken, wenn sie zu wenig Dauer, Halt, Festigkeit, Substanz und Glaubwürdigkeit zeigen? – Dann muss man ein bisschen Eigensinn und Dickköpfigkeit an den Tag legen. Ich denke da, um wieder an den Ursprung der europäischen Aufklärung zurückzukehren, an die um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts auftretenden Romangestalten von Henry Fielding. Lawrence Sterne und vor allem – Tobias Smollett. Nach den ziemlich überspannten Tugendengeln und den schwarzen Bösewichtern, die Richardson entworfen hatte, sind das nun ganze Menschen mit einer Variety of Fortunes, wie es bereits in einem Untertitel bei Defoe heißt. Menschen, die es in ihrem Leben nicht bis ›ganz oben‹ schaffen, die kein Prinz und keine Prinzessin küsst, deren Leistung vielmehr darin besteht, im gnadenlosen Getriebe der Welt nicht unterzugehen, sich auch angesichts der schwierigsten Umstände nicht unterkriegen zu lassen. Das sind Menschen, die auf den Rechten einer vielleicht etwas schmucklosen, aber keineswegs wertlosen Individualität beharren. Denn es gibt auch ein Leben außerhalb der Höfe, und es gibt auch eine Gesellschaft außerhalb der aristokratischen. Das ist eine Gesellschaft, die nicht immer nur im Licht agiert, sondern die auch mit vielen Schattenseiten fertig werden muss, mit den dunkleren, trüberen Erscheinungen. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie das für die Praxis aussieht – nicht nur für die Wahrnehmung, sondern für die Handhabung der Farbe? – Dann muss man sagen, wir befinden uns immer noch im Ausstrahlungsbereich des großen weiten Spektrums der Aufklärung, aber es wird jetzt ein bisschen anders interpretiert. Der Text ist immer noch der gleiche, aber die Handschrift ist eine andere, respektive es ist erst jetzt wirklich eine ausgeprägte Hand-Schrift, eine maniera, eine manière. Das ist ein in der Kunstgeschichte immer wieder zu beobachtendes Phänomen, dass man sich in Momenten, wo die Farbe als allzu willkürlich und oberflächlich erscheint, vermehrt auf den rein physischen, stofflichen, materialen Aspekt der Farbe besinnt, sozusagen auf die Körperlichkeit der Farbe. So wird die im Spektrum deklarierte Farbenvielfalt nicht mehr nur als Gedankenspiel, sondern durchaus seinsbezogen verstanden. Es ist ein etwas gebrochenes Verhältnis zur Wirklichkeit, das entsprechend auch nach gebrochenen Farben verlangt. Deshalb sollen auch die Schatten nicht länger verbannt sein, sie sollen wieder vermehrt mitreden können im gesellschaftlichen Gesamtbild. Der Schatten ist es, der erst den Wert des Lichts hervorbringt, ruft Diderot aus, nachdem er die tieferen Schatten der Kerker von Vincennes aus eigener Anschauung kennengelernt hatte. Mit diesen Überlegungen wären wir beim Stichwort picturesque angelangt. Historisch gesehen stammt das Konzept des Picturesque, des Pittoresken oder Malerischen ursprünglich aus Italien, genauer aus Venedig, und gelangt vor allem über die englische Rezeption in den aufklärerischen Diskurs. Nachdem the Picturesque aber in England heimisch geworden ist und zwar zunächst im Zusammenhang mit neuen Tendenzen in der Park-Gestaltung, avanciert es – zumindest im Rahmen der Aufklärung, zu einem wahren Lebensgefühl. Pittoresk ist etwas, worin man sich frei und ungehindert ergehen kann. So frei und ungehindert, dass es hier tatsächlich mehr als nur lautliche Anklänge gibt zwischen dem Brush-Work des englischen Malers und dem ›Buschwerk‹ des deutschen Gärtners. Wenn wir daran denken, dass auch für Kant die Malkunst einerseits aus der eigentlichen Malerei und andererseits aus der Lustgärtnerei besteht. In der eigentlichen Malerei meint the Picturesque einen freien, mit Freimut hingesetzten Farbauftrag. Gegenüber der akademisch geglätteten Feinpinselei bedeutet the Picturesque vor allem auch eine betonte Borstigkeit und Widerborstigkeit. Einen erklärten Widerwillen gegen das allzu Geglättete, Polierte, scheinbar Makellose. Und zugleich ein deutliches Bekenntnis zur lebendigen Praxis. Im Pittoresken kommt die Farbe ›zur Sache‹. Wir erleben den Übergang vom leuchtenden Signal zur konkreten Anleitung und Anweisung. Vor allem bedeutet the Picturesque aber ein Bekenntnis zur Individualität. 
Diderot schreibt in dem Nachruf auf seinen alten Morgenrock, in ihm habe er noch pittoresque et beau ausgesehen – malerisch und schön. In seinem neuen, noch ganz unverklecksten Morgenrock sehe er aus wie ein reicher Nichtstuer. Man ahne kaum noch, wer er wirklich sei. Wenn es überhaupt ein deutsches Pendant zu Diderot gegeben hat, dann war es sicherlich Gotthold Ephraim Lessing. In seiner Hamburgischen Dramaturgie unterscheidet er zwischen malerischen Gesten und pantomimischen. Die malerischen Gesten unterstreichen die Kernsätze einer bürgerlichen Identitätssuche, die pantomimischen sind einfach nur geschwätzig. August Wilhelm Schlegel ist dann so weit gegangen, die gesamte Kunst des christlichen Abendlands unter dem Prinzip des Malerischen zusammenzufassen – dies im Gegensatz zur antiken plastischen Kunst. Damit ist er sicherlich um einiges zu weit gegangen, aber es zeigt uns zumindest, wie weit die Ausstrahlungskraft der aufklärerischen Farbe – der Glanz von einer neuen Seite, auf der noch alles werden kann – letztlich gereicht hat.
Literaturhinweis: Andreas Hebestreit, Die soziale Farbe. Wie Gesellschaft sichtbar wird, LIT-Verlag 2007. Link zum Verlag mit Bestellmöglichkeit
|

